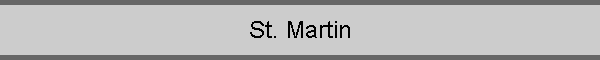|

Martinszug für 2006: Dienstag, 07.11.2006 / 18:00 Uhr / an der Rochusschule
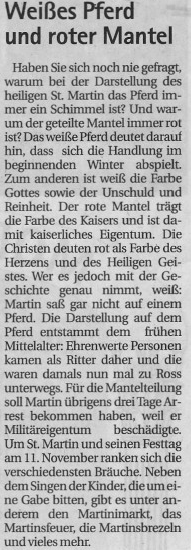
(Quelle: Sonntagspost 05.11.2005)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bekommt der Heilige Martin Konkurrenz?
Martinszüge endeten früher oft in Schlägereien
Rheinland. Wenn in den Tagen um den 11. November die Kinder wieder singend
durch die Straßen ziehen, dann tauchen neben den klassischen Laternen immer
häufiger auch ausgehöhlte Kürbisse mit Fratze in den Martinszügen auf. Diesen
aktuellen Trend führen die Volkskundler des Amtes für rheinische Landeskunde des
Landschaftsverbandes Rheinland auf den Einfluss von Halloween zurück.
Seit etwa zwei Jahren gehen die Kinder im Rheinland nicht
mehr nur zu Sankt Martin von Tür zu Tür, um Süßigkeiten zu sammeln. Schon am 31.
Oktober, dem Halloween-Abend, machen sich manche von ihnen in schaurig-schöner
Verkleidung auf den Weg und fordern nach amerikanischem Muster „Trick or Treat",
also „Süßes oder Saures". Damit scheinen die Martinszüge und das traditionelle „Schnörzen"
in den Tagen vor dem Martinsfest eine unerwartete Konkurrenz durch den neuen
Gruselbrauch aus den USA bekommen zu haben.
Streiche und Geister statt beschaulicher Martinslieder - kaum
jemand weiß, dass das Martinsfest auch früher schon nicht immer nur gesittet
verlief. Im 19. Jahrhundert endete es sogar oft in wilden Schlägereien. Es ging
recht derb zu, wenn die Kinder bei ihren Heischegängen um Brennmaterial für das
Martinsfeuer bettelten. Rivalisierende Gruppen versuchten, die Holzstöße
wechselseitig vorzeitig anzuzünden. Es kam zu Schlägereien, die sogar Eingang in
manche Martinsverse fanden. Aus der Geilenkirchener Gegend ist das 'Kampflied'
überliefert: "Zent Määrte, Zent Määrte, De Kalver hant lang Stärte, De Jonge
sent Rabaue, De Mädche wolle mer haue!"
Das alles mag den Kindern zwar viel Spaß gemacht haben, doch
Betteln, Prügeln und unkontrolliertes Hantieren mit dem Feuer lief allen
bürgerlichen Vorstellungen zuwider. Dr. Alois Döring, LVR-Volkskundler im Amt
für rheinische Landeskunde: "Das passte nicht in die ästhetische und
pädagogische Vorstellungswelt der bürgerlichen Gesellschaft. Erst versuchten die
Eltern dem Nachwuchs Manieren beizubringen, und dann tobten wüste Züge rüde
heischender Kinder durch die Straßen." Deshalb begannen die Erwachsenen, das
Martinsfest selbst in die Hand zu nehmen und zu reglementieren. Es begann in
Düsseldorf wo im späten 19. Jahrhundert schon von Umzügen mit Laternen berichtet
wird. Geschnitzte Kürbisse oder Rüben dienten dabei als Laternen: "Sobald der
Abend des 10. November herankam, befestigten die Kinder auf dem Boden des
Kürbisses eine Kerze, zündeten sie an und wanderten auf die Straße. Jeder ging
mit seinem Laternchen herum, wie er wollte. Das Gedränge wurde mit der Zeit
lebensgefährlich", so ein Zeitgenosse. Um 1890 überführte man deshalb das
"Durcheinander der Kürbis-Laternen" in wohlgeordnete Züge. Nach 1900 bürgerte
sich der reformierte, "pädagogisch wertvolle Martinsbrauch" mit Laternen-Umzug,
Ritt und Feuer ein, welchen bis heute Martinskomitees, Vereine oder Schulen
organisieren.
Quelle: 08.11.2001 - Birgit Karg / Presseamt LVR / 02 21 / 809-7711
http://www.lvr.de/app/Presse/Archiv.asp?NNr=13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Über 1.600 Jahre Gedenken an den
heiligen Martin von Tours
Von Doris
Richter
Vor kurzem hat Papst Johannes Paul II. bei
seinem Pastoralbesuch in Frankreich am Grab des heiligen Martin von Tours
gebetet. Dieser Heilige, der das Reich der Franken und die von ihnen besiedelten
Gebiete geprägt hat, war in der lateinischen Kirche der erste, der den Grad der
Heiligkeit nicht durch seinen heldenhaften Tod als Märtyrer, sondern durch sein
heroisches Leben erreichte. Vor mehr als 1.600 Jahren, am 8.11.397, ist der
dritte Bischof von Tours gestorben. Martin, personales Bindeglied zwischen Rom
und dem Frankenreich, verkörperte modellhaft für Jahrhunderte das neue
spätantike Priester- und Bischofsideal: Ein asketischer Mönch, gebildet und
tatkräftig zugleich, für den Kult und Kultur der gleichen Quelle entsprangen,
der lebte, was er predigte, der sich vor Christus beugte, um ihn herrschen zu
lassen. Am 11. November 1997 wurde zum eintausendsechshundertsten Mal seines
Todes gedacht.
„Mein Herr, es ist ein harter Kampf, den
wir in Deinem Dienste in diesem Dasein führen. Nun aber habe ich genug
gestritten. Wenn Du aber gebietest, weiterhin für Deine Sache im Felde zu
stehen, so soll die nachlassende Kraft des Alters kein Hindernis sein. Ich werde
die Mission, die Du mir anvertraust, getreu erfüllen. Solange Du befiehlst,
werde ich streiten. Und so willkommen dem Veteranen nach erfüllter Dienstzeit
die Entlassung ist, so bleibt mein Geist doch Sieger über die Jahre,
unnachgiebig gegenüber dem Alter.” Die überlieferten letzten Worte des heiligen
Martin klingen wie ein Rapport. Sie lassen die innere Einstellung eines
ehemaligen Soldaten erkennen: Disziplin und Pflichterfüllung kennzeichnen diesen
Mann, der sich nicht blind einem Gott unterworfen, sondern sich Gottes Sache zu
eigen gemacht hat. Schwärmerisches, unkontrolliertes Gefühl müssen diesem Mann
fremd gewesen sein.
Gesprochen wurden diese Worte im Jahr 397,
vor über 1.600 Jahren. Der diese Worte gesprochen hat, hieß Martinus und war
Bischof von Tours, schon zu Lebzeiten eine Legende. Von Geburt ein Römer,
stammte er aus einer Familie mit militärischer Tradition. Schon sein Name war
Programm: „Martinus” leitet sich ab vom Kriegsgott Mars. Man könnte den Namen
übersetzen als „zum (Kriegsgott) Mars gehörend” oder „Kämpfer, Kriegerischer”.
Durch Martin von Tours wurde dieser martialische Name von den Christen
übernommen. Er hatte einen neuen Sinn erhalten: „Martin” war nicht mehr länger
ein disziplinierter Kämpfer unter dem römischen Kriegsgott, sondern ein Soldat
Gottes, einer, der sich mit Eifer und Disziplin in die Pflicht der Kirche nehmen
ließ.
Martin teilt seinen Mantel
Zur Zeit des heiligen Martin galt ein
kaiserliches Edikt, wonach die Söhne von Berufssoldaten zum Kriegsdienst gezogen
wurden. Dadurch wurde auch Martin, gegen seinen Willen, mit 15 Jahren zum
Militärdienst eingezogen. Noch war Martin nicht getauft; aber in allem verhielt
er sich nicht, wie sich sonst Soldaten verhielten: Er war gütig zu seinen
Kameraden, wunderbar war seine Nächstenliebe. Seine Geduld und Bescheidenheit
überstiegen die der anderen bei weitem. Seine Kameraden verehrten ihn und
hielten ihn schon damals mehr für einen Mönch als einen Soldaten. Denn, obwohl
noch nicht getauft, zeigte er ein Verhalten wie ein Christ: Er stand den Kranken
bei, unterstützte die Armen, nährte Hungernde, kleidete Nackte. Von seinem Sold
behielt er nur das für sich, was er für das tägliche Leben benötigte.
Eines Tages, als Martin nichts außer Waffen
und dem einfachen Soldatenmantel bei sich trug, begegnete er mitten im Winter,
der von so außergewöhnlicher Härte war, dass viele erfroren, am Stadttor von
Amiens einem nackten Armen. Dieser flehte die Vorbeigehenden um Erbarmen an.
Doch alle liefen an dem Elenden vorüber. Da erkannte Martin, von Gott erfüllt,
dass der Arme, dem die anderen keine Barmherzigkeit schenkten, für ihn da sei.
Aber was sollte er tun? Außer seinem
Soldatenmantel hatte er ja nichts. Also nahm er sein Schwert und teilte den
Mantel mitten entzwei. Den einen Teil gab er dem Armen, in den anderen Teil
hüllte er sich wieder selbst. Etliche der Umstehenden begannen zu lachen, denn
Martin sah mit dem halben Mantel kümmerlich aus. Viele jedoch, die mehr Einsicht
hatten, bedauerten sehr, dass sie nicht selbst geholfen hatten, zumal sie viel
wohlhabender als Martin waren und den Armen hätten bekleiden können, ohne sich
selbst eine Blöße zu geben.
In der folgenden Nacht, als Martin in
tiefem Schlafe lag, sah er Christus mit seinem halben Soldatenmantel bekleidet,
den er dem Armen gegeben hatte. Ihm wurde befohlen, er solle sehr aufmerksam den
Herrn und das Kleidungsstück, das er verschenkt habe, ansehen. Dann hörte Martin
Jesus mit lauter Stimme zu der umstehenden Engelschar sprechen: „Martin, der
noch Katechumene (= Taufbewerber) ist, hat mich mit diesem Mantel bekleidet".
Jesus Christus dachte dabei tatsächlich an seine eigenen Worte, die er einst
gesprochen hatte: „Was immer ihr einem Geringsten getan habt, das habt ihr mir
getan" (Mt 25, 40). So bekannte Jesus Christus, dass er in dem Armen von Martin
bekleidet worden ist. Um den Wert eines so guten Werkes zu bestätigen, zeigte er
sich in eben diesem Mantel. Dieses Traumgesicht verführte Martin aber keineswegs
zu menschlicher Ruhmsucht. Er erkannte in seiner Tat vielmehr die Güte Gottes.
Und als er 18 Jahre alt war, ließ er sich taufen.
Martin erweckt Tote
Als Martin getauft, aber noch nicht Bischof
war, lebte er einige Zeit in einer von ihm bei Poitiers gegründeten Einsiedelei,
um sich bei dem heiligen Hilarius von Poitiers zu vervollkommnen. In dieser Zeit
schloss sich ihm eine Katechumene an, der sich in der Lebensweise Martins
unterweisen lassen wollte. Schon nach wenigen Tagen wurde er jedoch schwer
krank. Ihn plagte heftig schweres Fieber. Martin aber war gerade abwesend. Als
er nach drei Tagen wiederkam, fand er den entseelten Körper. Der Tod war so
plötzlich gekommen, dass er ohne Taufe gestorben war. Die bekümmerte Schar der
Brüder umgab den aufgebahrten Leichnam. Unter Tränen und Seufzen kam Martin
hinzu. Er fühlte sich innerlich vom Heiligen Geist erfüllt. Er wies die Brüder
aus der Zelle, in der der Tote lag, verriegelte die Tür und legte sich über den
toten Leib des verstorbenen Bruders. Eine Zeitlang betete er und fühlte dann,
dass der Geist ihm eine besondere Kraft des Herrn mitteilte. Dann richtete er
sich ein wenig auf, blickte den Toten unverwandt an und wartete voll Zuversicht
auf die Frucht seines Gebetes und der göttlichen Barmherzigkeit.
Kaum waren zwei Stunden vergangen, da sah
er, wie der Tote nach und nach alle Glieder bewegte; die Augen öffneten sich und
begannen blinzelnd zu sehen. Mit lauter Stimme wandte sich der Bruder an den
Herrn. Seine starken Dankesworte erfüllten die ganze Zelle. Als die vor der
Zelle Stehenden dies vernahmen, kamen sie schnell herein. Ihnen bot sich ein
wunderbares Schauspiel: Sie sahen den leben, den sie tot verlassen hatten. Auf
diese Weise dem Leben zurückgegeben, empfing der Bruder sofort die Taufe. Er
lebte noch viele Jahre und war der erste, der von Martins Wunderkraft Zeugnis
geben konnte.
Dieser Bruder erzählte davon, dass er nach
seinem Sterben vor den Richterstuhl geführt worden sei. Dort habe er einen
furchtbaren Urteilsspruch vernommen, der ihn an den Ort der Finsternis zu den
Verdammten verwies. Plötzlich sei dem Richter von zwei Engeln bedeutet worden,
das sei jener Mann, für den Martin bete. Da wurde den beiden Engeln aufgetragen,
ihn dem fürbittenden Martin wiederzuschenken und dem früheren Leben
zurückzugeben. Von da an war Martin nicht nur als Heiliger, sondern als
Wundertäter berühmt.
Nicht sehr viel später kam Martin an dem
Landgut eines Lupizinus vorüber, eines angesehen Mannes. Martin vernahm das
laute Schreien und Klagen einer trauernden Menge. Er näherte sich und fragte
nach dem Anlass des Klagens. Man erklärte ihm, einer der Knechte habe sein Leben
mit dem Strick beendet. Nach dieser Auskunft ging er in die Kammer, in der der
Tote lag, und schickte die Leute hinaus. Er legte sich über die Leiche und
betete.
Bald nahm das Gesicht des Toten wieder
Farbe an. Er richtete die noch müden Augen auf Martins Gesicht und versuchte
sich langsam aufzurichten. Dann fasste er die Rechte Martins und stellte sich
auf die Füße. Er ging mit Martin bis zur Eingangshalle des Hauses, wo ihn alle
Leute sahen.
Martin wird Bischof von Tours
In jener Zeit (etwa 371/372) berief man
Martin auf den Bischofsstuhl von Tours. Martin aber wollte sich seinem Kloster
nicht entreißen lassen. Da warf sich ein Bürger mit dem Namen Rusticus Martin zu
Füßen und gab vor, seine Frau sei krank und Martin müsse mitkommen, denn nur er
könne ihr das Leben erhalten. Damit wollte Rusticus erreichen, dass der Heilige
mitkomme.
Die Bürger von Tours hatten sich schon
entlang des Weges aufgestellt und wie unter Bewachung geleiteten sie Martin in
die Stadt. Wunderbarerweise hatte sich nicht nur eine unglaubliche Menge aus der
Stadt, sondern auch aus den Nachbarstädten zur Bischofswahl eingefunden. Alle
hatten nur einen Wunsch, eine Stimme und eine Meinung: Martin sei der Würdigste
für das Bischofsamt, mit einem solchen Bischof sei die Kirche wirklich glücklich
zu schätzen. Allerdings widersprachen dem gewissenlos eine kleine Zahl der Leute
und etliche unter den Bischöfen, die zur Einsetzung des Bischofs herbeigerufen
worden waren. Sie behaupteten, Martin sei ein verachtenswerter Mensch: Einer von
so kümmerlichem Aussehen, mit schmutzigem Kleid und ungepflegten Haaren sei
unwürdig, Bischof zu werden. Das Volk aber war klügeren Sinnes und hielt diese
Meinung für lächerliche Torheit. Jene wollten einen berühmten Mann verachten,
verkündeten doch dabei sein Lob. Die Wahlversammlung konnte nichts anderes tun,
als was das überwiegende Volk mit Gottes Willen forderte.
Martin - so erzählt eine jüngere Legende -
hatte sich während der Diskussionen entfernt und suchte sich vor der Menge zu
verbergen, um der Bischofsernennung zu entgehen. Da er keinen geeigneten Ort
fand, suchte er schließlich in einem Gänsestall Zuflucht. Als die Menge ihn
suchte, fand sie ihn in diesem Gänsestall, weil die Gänse durch lautes Geschrei
auf den heiligen Mann aufmerksam machten. So hat also Martin das Bischofsamt
übernommen.
Martin fällt einen angeblich heiligen
Baum
Als Martin einmal in einer Siedlung einen
alten Heidentempel zerstörte und eine benachbarte Kiefer umhauen wollte, kamen
die Heiden und wollten ihn daran hindern. Durch Gottes Willen hatten sie sich
still verhalten, als der Tempel eingerissen wurde. Sie wollten aber nicht
dulden, dass der Baum gefällt werde. Mit großem Eifer versuchte ihnen Martin zu
erklären, dass in einem Baum nichts Heiliges sein könne. Sie sollten doch lieber
dem Gott folgen, dem er selber diene. Weil der Baum einem Dämon geweiht sei,
müsse er umgehauen werden.
Da trat ein besonders Verwegener vor und
sprach: „Wenn du Vertrauen zu dem Gott hast, den du zu verehren vorgibst, dann
wollen wir selbst den Baum fällen. Du aber sollst ihn in seinem Fall aufhalten.
Wenn dann dein Gott wirklich mit dir ist, wirst du dem Urteil entkommen." Martin
zweifelte nicht an Gott und war bereit, auf den Vorschlag einzugehen. Alle
Heiden stimmten dieser Abmachung zu. Ihren Baum würden sie gerne fällen, wenn
sie durch den fallenden Baum zugleich den Feind ihrer Heiligtümer erledigen
konnten.
Die Kiefer stand nach einer Seite geneigt.
Es bestand gar kein Zweifel, nach welcher Seite sie fallen würde. Ausgelassen
und voll Freude machten sich die Heiden daran, ihre Kiefer zu fällen. Dabei
stand eine große Schar Schaulustiger. Da begann sich die Kiefer zu neigen und
drohte zu stürzen. Ziemlich entfernt standen zitternd die Mönche. Sie waren
wegen der drohenden Gefahr entsetzt und hatten alle Hoffnung aufgegeben. Sie
warteten nur noch auf Martins Tod. Doch der vertraute auf den Herrn und wartete
ohne Angst.
Schon ächzte die Kiefer im Fallen, schon
neigte sie sich, schon stürzte sie auf ihn: Da streckte Martin seine Hand gegen
sie aus und zeichnete das Zeichen des Heils gegen sie.
Dann, wie wenn ein Wirbelwind den Baum
umgedreht hätte, fiel er nach der entgegengesetzten Seite. Fast hätte er das
wilde Volk, das sich dort sicher fühlte, erschlagen.
Nun erhob sich ein Geschrei zum Himmel. Die
Heiden staunten über das Wunder. Die Mönche weinten vor Freude. Von allen
gemeinsam wurde der Name Christi gepriesen. Ganz sicher ist an diesem Tag auch
in diese Gegend das Heil gekommen. Fast keinen in der großen Heidenschar gab es,
der nicht um die Handauflegung bat, den heidnischen Irrtum aufgab und an den
Herrn Jesus glaubte.
Martin heilt Kranke
Martin besaß die Gabe der Krankenheilung in
einem solchen Ausmaß, dass kaum ein Kranker zu ihm kam, der nicht augenblicklich
die Gesundheit wieder gefunden hätte. Die antiken lateinischen
Lebensbeschreibungen des Heiligen enthalten dazu viele Erzählungen. 385 oder 386
hielt sich Martin in Trier auf. Dort litt ein Mädchen an sehr schwerer Lähmung.
Ihr Körper versagte schon seit langer Zeit jeglichen Dienst. Eigentlich war
schon der ganze Leib des Mädchens tot; es war nur noch ein schwacher Lebenshauch
in ihr. Schon standen die Verwandten voll Trauer bei der Sterbenden und warteten
auf das Begräbnis. Plötzlich ging wie ein Lauffeuer durch die Stadt die
Botschaft, Bischof Martin sei gekommen. Als der Vater des Mädchens davon hörte,
lief er atemlos, um für seine Tochter zu bitten. Doch Martin hatte gerade die
Kirche betreten. Vor allen Anwesenden und den versammelten Bischöfen umschlang
der Greis weinend Martins Knie und sagte: „Meine Tochter stirbt an einer
schrecklichen Krankheit. Aber noch viel grausamer als der Tod selber ist, dass
sie schon jetzt nur noch im Geist lebt, weil ihr Fleisch schon fast tot ist. Ich
bitte dich darum, dass du zu ihr gehst und sie segnest. Ich vertraue darauf,
dass ihr durch dich die Gesundheit zurück geschenkt werden kann". Martin war
durch diese Rede verwirrt und entsetzt und versuchte zu fliehen. Er sagte,
solches gehe über seine Kraft. Der alte Mann habe eine völlig falsche Meinung
über ihn. Es sei absolut unwürdig, dass Gott durch ihn Zeichen seiner
Wundermacht wirke. Aber der Vater ließ sich nicht abweisen, weinte heftig und
flehte, die Sterbende doch aufzusuchen. Schließlich drängten auch die anwesenden
Bischöfe Martin, zu der Tochter des Bittstellers zu gehen. Da ging er endlich zu
dem Haus des Mädchens.
Vor der Tür stand eine große Menge und
wartete, was Martin tun werde. Zuerst warf sich Martin auf den Boden und betete.
In solchen Fällen waren dies seine gewöhnlichen Waffen. Dann schaute er die
Kranke an und ließ sich Öl geben, segnete es und goss den wunderkräftigen
heiligen Trank in den Mund des Mädchens. Diese erhielt sofort wieder ihre Stimme
zurück. Nach der Berührung durch Martin belebten sich auch die einzelnen Glieder
wieder, bis sie schließlich auf festen Füßen vor das Volk treten konnte, das die
Heilung bezeugte.
In Paris geschah es, als Martin mit
zahlreichen Begleitern durch das Stadttor zog, dass er einen Aussätzigen mit
schrecklich entstelltem Gesicht, das Schrecken einjagte, küsste und segnete. Auf
der Stelle war jener von aller Unreinheit befreit. Am anderen Tag kam jener mit
glänzend weißer Hautfarbe zur Kirche, um für die wieder erhaltene Gesundheit zu
danken.
Martin und der Kaiser
In Trier residierte zu Lebzeiten des
heiligen Martin Kaiser Maximus, der 383 von seinen Truppen in Britannien zum
Kaiser erhoben worden war und von Trier aus das römische Westreich bis zu seinem
späteren Sturz 388 regierte. Während andere Bischöfe durch Schmeichelei bei Hofe
ihre Ziele verfolgten, vermied Martin ein Zusammentreffen mit dem Usurpator.
Martin wollte nicht am Tisch dessen sitzen, der einen Kaiser um sein Reich und
einen anderen um sein Leben gebracht habe.
Als aber aus den verschiedenen Teilen der
Welt Bischöfe zum Kaiser gekommen waren, um durch üble Kriecherei die
Verurteilung des der Ketzerei angeklagten Spaniers Priscillian zu erreichen,
weil sich diese Bischöfe nicht scheuten, ihre bischöfliche
Würde geringer zu schätzen als die
kaiserliche Gunst, überwand Martin seine Bedenken gegen den Kaiser und folgte
einer Einladung zu einem kaiserlichen Mahl. Wie bei einem Festtag kamen die
höchsten und angesehensten Männer zusammen. Mitten unter ihnen saß der Priester,
der Martin begleitete, während Martin selbst neben dem Kaiser saß. Etwa nach dem
halben Mahle reichte ein Diener dem Herrscher die Trinkschale, so wie es üblich
war. Doch dieser befahl, die Trinkschale erst Bischof Martin zu reichen. Er
erhoffte sich dadurch, die Trinkschale aus der Hand Martins zu erhalten. Als
Martin getrunken hatte, gab er aber die Schale an seinen priesterlichen
Mitbruder weiter. Der Bischof meinte nämlich, niemand sei würdiger als erster
nach ihm zu trinken; es sei Unrecht, den Herrscher oder einen aus seiner
Umgebung dem Priester vorzuziehen.
Der Kaiser und alle Anwesenden wunderten
sich darüber so sehr, dass ihnen die Zurücksetzung sogar gefiel. Im ganzen
Palast wurde Martin gerühmt, weil er am Tisch des Kaisers getan hatte, was am
Tisch niederer Beamter kein Bischof zu tun gewagt hätte.
Der grausame Richter und der Diener
Gottes
Claudius Avitianus war beauftragt, Gallien
zu inspizieren und hatte zu diesem Zweck außerordentliche richterliche
Vollmachten erhalten. Seine Grausamkeit, sein maßloser Zorn versetzten die
Bewohner der Provinz in Furcht und Schrecken. Als er in die Stadt Turonen
einzog, folgten ihm zahlreiche Gefangene, die mit Ketten gefesselt waren und
sehr elend aussahen. Avitianus ließ für die Gefangenen Marterwerkzeuge
bereitstellen. Er setzte die Bestrafung auf den folgenden Tag fest.
Davon hörte Martinus, der noch in der
gleichen Nacht zum Palast des Richters eilte. Dort schlief schon alles; die Tore
waren fest verriegelt. Martinus warf sich vor der Schwelle nieder, mit dem
Gesicht zur Erde. Während er betete, weckte ein Engel den Richter und sagte zu
ihm: „Wie kannst du schlafen, wenn ein Diener Gottes vor deiner Schwelle liegt?"
Verwirrt sprang Avitianus aus dem Bett, rief seine Diener und erklärte ihnen
zitternd, Martinus warte vor der Tür, sie sollten ihn hereinbitten. Aber die
Diener lachten über ihren Herrn und glaubten, er sich durch einen Traum täuschen
lassen. Deshalb sahen sie nur flüchtig nach. „Es ist niemand da", sagten sie zu
Avitianus. „In einer kalten und unfreundlichen Nacht wie dieser hält sich kein
Mensch draußen auf."
Der Richter war beruhigt und fiel wieder in
den Schlaf. Aber bald wurde er noch heftiger geweckt. Er wollte seine Diener ein
zweites Mal hinausschicken. Als sie zögerten, ging er selbst bis zum äußersten
Tor, wo er Martinus traf. „Herr, warum hast du mir das angetan?" fragte er. „Ich
kann keine Ruhe mehr finden. Geh rasch fort, denn ich habe genug gebüßt." Weil
der Heilige noch immer wartete, fügte er hinzu: „Ich weiß, was du verlangst, und
werde alles nach deinem Wunsch erfüllen."
Am nächsten Morgen rief Avitianus seine
Schergen. Er befahl, den Gefangenen die Ketten abzunehmen. Dann verließ er die
Stadt, in der Freude und Jubel herrschten.
Die Heiligen Severin und Ambrosius
erleben den Tod des Martin
Sankt Severin, Erzbischof von Köln, umging
des Sonntags nach der Frühmette die heiligen Stätten wie seine Gewohnheit war.
Da hörte er um dieselbe Stunde, als der heilige Martin verschieden war, die
Engel im Himmel singen. Er rief seinen Archidiakon und fragte ihn, ob er etwas
höre. Der sprach, er höre nichts. Da mahnte ihn der Erzbischof, er solle mit
Fleiß hören; also streckte jener den Hals in die Höhe, reckte die Ohren und
stand auf den Fußspitzen, auf seinen Stab gestützt.
Und weil der Erzbischof für ihn betete,
sprach er, dass er etliche Stimmen im Himmel höre. Da sprach der Bischof: „Mein
Herr Martinus ist von dieser Welt geschieden, und die Engel tragen seine Seele
gen Himmel."
Es waren auch Teufel da, die wollten ihn
zurückhalten, aber da sie nichts an ihm fanden, was ihnen zugehörte, mussten sie
beschämt weichen. Der Archidiakon aber merkte sich Tag und Stunde und erfuhr
später, dass Martinus um diese Zeit gestorben war.
Am selben Tag geschah es auch, dass Sankt
Ambrosius, Bischof von Mailand, als er die Messe las, über dem Altar zwischen
den Propheten und der Epistel einschlief. Da wagte ihn niemand zu wecken, und
der Subdiakon traute sich ohne seine Gebot nicht die Epistel zu lesen. Als aber
zwei oder drei Stunden vergangen waren, weckten sie ihn doch und sprachen:
„Schon ist die Stunde vorüber und das Volk ist müde und wartet. So möge unser
Herr gebieten, dass der Kleriker die Epistel lese." Da antwortete Ambrosius:
„Lasst euch nicht betrüben, aber wisset, mein Bruder Martinus ist gestorben, und
ich bin bei seinem Begräbnis gewesen und habe es mit Feier begangen. Weil ihr
mich geweckt habt, konnte ich die letzte Respons nicht vollbringen.“ Da merkten
sie sich den Tag und die Stunde, und fanden, dass Sankt Martin um diese Zeit in
den Himmel gefahren sei.
Der Blinde und der Lahme
Zur Zeit der Beisetzung des heiligen Martin
gab es zwei Gesellen, der eine blind, der andere lahm. Der Blinde trug den
Lahmen auf dem Rücken, und der Lahme wies dem Blinden den Weg. Sie bettelten
miteinander und verdienten großes Gut. Da hörten sie erzählen, dass bei Sankt
Martins Leichnam viele Kranke gesund geworden seien. Und weil sein Leib am Tag
seiner Überführung in einer Prozession um die Kirche getragen wurde, waren sie
bange, der Leib würde bei dem Haus vorübergetragen werden, in dem sie wohnten
und sie würden plötzlich geheilt werden. Sie aber wollten nicht geheilt werden,
damit sie nicht die Ursache ihres gewinnbringenden Einkommens verlören. Darum
flohen sie aus der Straße und gingen in eine andere Gasse, durch den der
Leichnam, wie sie glaubten, nicht getragen würde. Aber als sie flohen,
begegneten sie dem Leichenzug unversehens. Und weil Gott den Menschen manche
Wohltat wider ihren Willen tut, wurden sie beide gegen ihren Willen gesund und
waren doch darüber betrübt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Martinstag (am 11.
November) als Festtag des Heiligen Martin von Tours (* um 316 /
317 in Sabaria, römische Provinz Pannonien, heute Szombathely,
Ungarn; † 8. November
397
in Candes bei Tours) ist von zahlreichen Bräuchen geprägt.
Frühere Bedeutung im Jahresablauf
Die verschiedenen Bräuche wurzeln in zwei wohl zusammenhängenden
Umständen:
Der Martinstag lag in der von Byzanz beeinflussten Christenheit
zunächst am Beginn der 40-tägigen Fastenzeit ab dem 11.
November, die vom Mittelalter bis in die Neuzeit hinein – in den
Orthodoxen Kirchen teilweise bis heute – vor Weihnachten
begangen wurde. Am letzten Tag vor Beginn der Fastenzeit –
analog zur Fastnacht – konnten die Menschen noch einmal
schlemmen.
Auch beim rheinischen Karneval bzw. in der Mainzer
Fastnachtstradition wird die neue „Session“ bzw. Kampagne am 11.
November ausgerufen. Der Martinstag war auch der traditionelle
Tag des Zehnts. Die Steuern wurden früher in Naturalien bezahlt,
auch in Gänsen, da die bevorstehende Winterzeit das Durchfüttern
der Tiere nur in einer eingeschränkten Zahl möglich machte.
Martinsgans-Essen
Als Brauch ist heute vor allem das
traditionelle Martinsgans-Essen verbreitet. Es hat seinen
Ursprung angeblich in einer Episode aus Martins Leben: Als man
ihn zum Bischof von Tours ernennen wollte, versteckte er sich
einer Legende nach in einem Gänsestall, weil ihm die hohe
Verantwortung Angst machte. Die Gänse schnatterten so laut, dass
Martin gefunden wurde. Als „Strafe“ werden daher an seinem
Gedenktag die Gänse verspeist. Einer anderen Erzählung nach
verwandten die Bürger von Tours eine List: Rusticus ging nämlich
zu Martins Versteck und bat diesen, seine kranke Frau zu
besuchen. Hilfsbereit, wie Martin nun einmal war, nahm er seine
Sachen, um Rusticus nach Hause zu begleiten. Wahrscheinlich sah
er ziemlich schmutzig aus – als habe er eine Zeit lang in einem
Gänsestall gelebt.
Sankt-Martins-Zug
bzw. Umzug
In vielen Regionen Deutschlands sind Umzüge
zum Martinstag üblich. Heutzutage findet er mancherorts aber
auch davor oder danach statt, wenn es organisatorische Gründe
erfordern. Die Tradition des Umzuges ist sehr regional. Im
Münsterland, im Rheinland und in Oberschwaben sind solch
Veranstaltungen üblich. In Erfurt findet ein Umzug statt,
während die umliegenden Gemeinden zumeist keinen haben. Ähnlich
ist es in Mülheim an der Ruhr, wo ein solcher Umzug stattfindet,
während es im benachbarten Essen keine solche Tradition gibt.
Der Brauch ist nicht nur auf Deutschland beschränkt. So
veranstaltet die deutsche Gemeinde in Stockholm einen
Martinsumzug.
Beim Umzug ziehen Kinder zum Gedenken an den
Heiligen Martin mit Laternen durch die Straßen der Dörfer und
Städte, begleitet von einem auf einem Schimmel sitzenden und als
römischer Soldat verkleideten Reiter, der mit einem roten Mantel
den Heiligen darstellt. Gelegentlich wird auch die Schenkung des
Mantels an den Bettler nachgestellt. Bei dem Umzug werden
Martinslieder gesungen. Die Laternen werden oft vorher im
Unterricht der Grundschulen und in Kindergärten gebastelt.
Zum Abschluss gibt es häufig ein
Martinsfeuer, und die Kinder erhalten einen Weckmann aus
Hefeteig mit Rosinen. In Süddeutschland sind auch Laugenbrezeln
üblich.
Den wohl größten St.-Martins-Zug Deutschlands
kann man am 10. November, dem Vorabend zum eigentlichen
Martinstag, in Kempen/Niederrhein erleben. Tausende von Kindern
ziehen dort nach Einbruch der Dämmerung durch die Straßen der
historischen Altstadt, begleitet von zahlreichen Musikkapellen
und angeführt vom berittenen Sankt Martin mit seinen zwei
Herolden. Der Zug, dessen Höhepunkt ein Großfeuerwerk an der
Kurkölnischen Burg ist, wird Jahr für Jahr vom St.-Martin-Verein
Kempen e.V. organisiert.
In Franken kennt man anstelle des Weckmanns
auch den „Belzermärtl“, den „Pelzmärtel“ (Martin im Pelz) oder
den „Nussmärtel“. Im evangelischen Franken bringt mancherorts
der Pelzmärtel auch anstatt des Nikolaus Geschenke für die
Kinder. Der Name dieser Gestalt geht ganz eindeutig auf den
Heiligen Martin zurück, allerdings war der Pelzmärtel keineswegs
mit diesem identisch. Seinem Aussehen nach ist er ganz eindeutig
ein „Kollege“ von Knecht Ruprecht, Pelznickel & Co. Tatsächlich
ist er im Gefolge der Reformation aufgetaucht, die den
Nikolausbrauch und die Verehrung der Heiligen - also auch des
Heiligen Martin - in evangelischen Gegenden abgeschafft hatte.
Der Pelzmärtel kam dann in Franken gewissermaßen stellvertretend
für den Nikolaus und dessen finsteren Begleiter und erinnerte
gleichzeitig an den populären Hl. Martin.
Im Anschluss an den Martinszug oder auch an
einem leicht abweichenden Termin wird vielerorts auch das
Martinssingen praktiziert, bei dem die Kinder mit ihren Laternen
von Haus zu Haus ziehen und mit Gesang Süßigkeiten erbitten.
Martinisingen
In Ostfriesland gibt es einen ähnlichen
Brauch, der sich aber aus einer anderen Richtung entwickelt hat.
Dort geht das so genannte Martinisingen am 10. November auf
Martin Luther, anstatt auf den heiligen Martin, zurück.
Martinisingen ist ein alter protestantischer,
stellenweise auch außerhalb Ostfrieslands in anderen
norddeutschen Regionen bekannter Brauch, bei dem ähnlich dem
Martinssingen mit Laternen von Haus zu Haus gezogen wird.
Geschichte:
Es ist ein Brauch, in dem sich mehrere Ursprungselemente
mischen. Traditionell war der 10. November der Tag, an dem
Landarbeiter und Dienstpersonal über Winter entlassen wurden.
Für diese weitgehend besitzlosen Bevölkerungsschichten galt es
nun, eine ausgesprochene Notzeit zu überstehen. Einen Beitrag
dazu leisteten dann die Kinder, die an diesem Tag von Haus zu
Haus zogen und insbesondere bei wohlhabenden Bauern und Bürgern
um Gaben bettelten. Was sie dabei einsammelten waren
ursprünglich Lebensmittel, die tatsächlich für den Wintervorrat
mit eingelagert werden und nach und nach verzehrt werden
konnten.
Später wandelten sich diese Gaben mehr und
mehr zu symbolischen Spenden und heute gibt es überwiegend
Süßigkeiten. Zu den traditionellen Gaben dagegen gehören Moppen
(moppen) und Pfeffernüsse (pēpernööten) sowie Äpfel.
Das Betteln um Gaben erfolgte in gereimten
Sprüchen oder dem Vortrag entsprechender Lieder wobei die Kinder
Laternen (kipkapköögels) mit sich führten, die früher aus einer
Runkelrübe geschnitzt wurden. Später benutzte man wohl auch
gelegentlich kleine Kürbisse dazu und es setzten sich nach und
nach farbige Papierlampions durch, wie sie noch heute
gebräuchlich sind. Auch verschiedene selbst gefertigte
Geräuschinstrumente (Rasseln, Rummelpott) kamen zum Einsatz.
Schon früher pflegten insbesondere die etwas
älteren Sänger sich auch zu verkleiden oder Gesichtsmasken (sğabellenskoppen)
aufzusetzen. Diese Sitte überwiegt mittlerweile und man sieht zu
Martini allerorten eine Vielzahl teilweise phantasievoller
Verkleidungen.
In Ostfriesland mischte sich inhaltlich das
ursprüngliche Motiv des Bettelns mit Ausbreitung der Reformation
mit religiösen Motiven und der Verehrung des Reformators Martin
Luther. Die protestantische Kirche war gezwungen, auf die
ursprünglich katholische Sitte zu reagieren. Anlässlich der
300-Jahrsfeier der Reformation von 1517 wurde 1817 das
Martinisingen auf den Vorabend des Martinstages vorgezogen. Von
da an wurde nur noch Martin Luther, der „Lichtfreund und der
Glaubensmann" gefeiert, „de de Papst in Rom de Kroon offschlog".
So wurde denn auch der Martinstag mit dem Martinisingen auf 10.
November, den Geburtstag des Reformators, vorverlegt. Zunehmend
wurde als Anlass des Martinisingens die Feier des Geburtstages
Luthers herausgestellt und das Bettelmotiv mit Gebräuchen der
Mönchsorden erklärt. Die vorgetragenen Lieder bekamen eine
religiöse Färbung oder es wurden neue geschaffen, die allein der
religiösen Bedeutung des Tages Rechnung trugen bzw. sich auf die
Verehrung Martin Luthers bezogen.
In anderen Bereichen Deutschlands ging diese
Vermischung andere Wege. Dort geht der Martinstag einen Tag
später am 11. November auf den heiligen Sankt Martin von Tours
zurück. Die Feier wird es mit einem Laternenumzug durch die
Dörfer und Städte eingeläutet, an dessen Ende die Mantelteilung
zelebriert wird und Weckmänner verteilt werden, die man in
Ostfriesland als Klaaskerle kennt und hier aber eher an den
heiligen St Nikolaus erinnern. Daran schließt sich das
Martinisingen an.
Seit Ende der neunziger Jahre macht sich auch
die Werbung der Geschäfte und amerikanische Fernsehserien das
irisch-amerikanische Halloween als Konkurrenz gegen das
Martinisingen bemerkbar, auch durch die Begeisterung einiger
Erzieher in Grundschulen und Kindergärten, das neue Fest wird
aber, von Diskotheken abgesehen, kritisch gesehen und weitgehend
noch abgelehnt.
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Martinstag#Sankt-Martins-Zug_bzw._Umzug
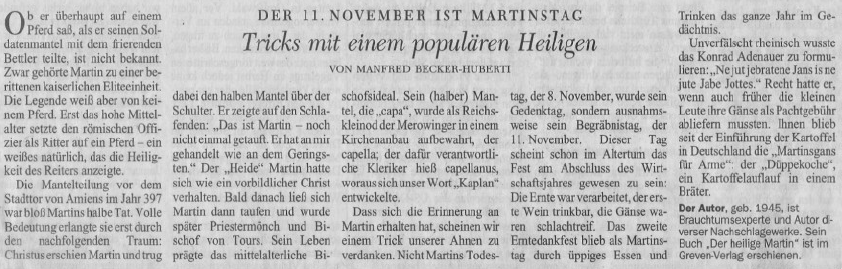
Quelle: KStA vom 11./12.11.2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelle: Werbepost vom 07.11.2007
 Quelle:
Werbepost vom 02.11.2011
|